
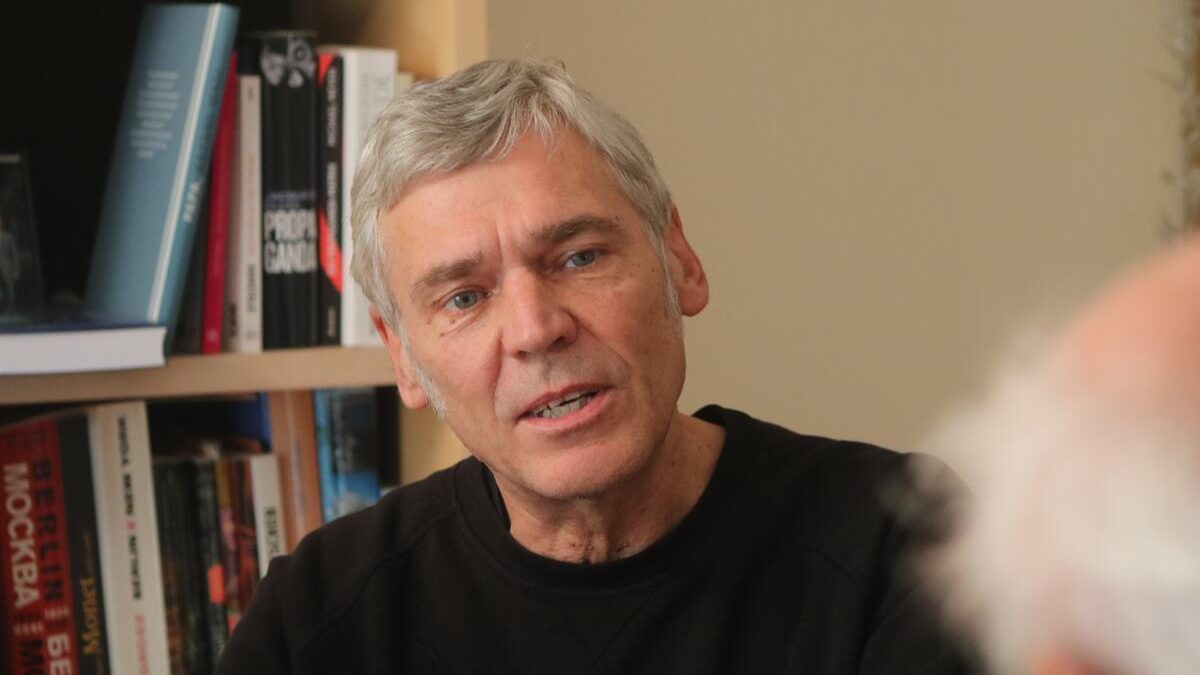
Eine Gruppe politisch aktiver Menschen plant die Einführung der Direkten Demokratie im Bundesland Bremen. Mit Hilfe einer neu entwickelten Internetplattform sollen alle Bremer mit darüber abstimmen, welche Gesetze in der Bremischen Bürgerschaft verabschiedet werden. Die Kandidaten der Partei dieBasis treten zur Bürgerschaftswahl am 14. Mai mit dem Versprechen an, das so ermittelte Mehrheitsvotum der Bürger ins Parlament zu tragen. Jochen Hering, ehemaliger Lehrer, Literaturwissenschaftler und Journalist, sprach mit drei Vertretern des Aktionsteams: Erich Sturm, Vorsitzender des Landesverbands Bremen der Partei dieBasis; Martin Wandelt, Entwickler der Abstimmungssoftware, und Martin Fülbier, Vorstand der GVdW (Gesellschaft für Verfahren zur direktdemokratischen Willensbildung), die sich um die Organisation der Bürgerabstimmungen kümmern wird.
Hinweis: Dieses Interview kann man sich auch als Video ansehen.
JH: Bei dem Begriff „Direkte Demokratie“ denken die meisten Menschen an so etwas wie Volksabstimmungen, Volksbefragungen, vielleicht sogar Volksversammlungen. Was versteht ihr darunter und was bezweckt ihr damit?
ES: Ich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die repräsentative Demokratie an vielen Ecken und Enden knirscht und dass wir neue Ansätze brauchen – politische Ansätze, um die Bevölkerung nicht nur zu beteiligen, sondern auch zur Mitbestimmung zu bringen. Wir betrachten das nicht so wie die Schweizer, wo man jeweils ein Thema zur Abstimmung stellt, sondern wir wollen, dass sämtliche Gesetze, die in Bremen zur Abstimmung kommen, der Bevölkerung nahegebracht werden, dass die Menschen informiert werden und dass sie dann ihr Votum abgeben können.
JH: Martin, du bist Softewareentwickler. Hat dieser Beruf etwas mit Direkter Demokratie zu tun?
MW: Im Grunde ja. Die üblichen Formen der Direkten Demokratie, wie zum Beispiel Volksbegehren und Volksentscheide, sind immer mit sehr hohem Aufwand verbunden, wenn man sie auf traditionelle Weise umsetzen will. Das sieht man ja in der Schweiz, dem Land, wo die Direkte Demokratie am weitesten umgesetzt ist. Selbst dort gibt es nur wenige Abstimmungen – oder Abstimmungstermine – pro Jahr. Mit unserer Software haben wir das Werkzeug, eine viel fließendere Art direktdemokratischer Prozesse innerhalb einer Stadt, eines Bundeslandes oder der gesamten Bundesrepublik umzusetzen.
ES: Das Digitale ermöglicht einen Dialog, ein Hin und Her. Im klassischen Sinne, beispielsweise in der Schweiz, wird einfach ein Gesetz vorgestellt und darüber abgestimmt. Da werden zwar auch Informationen verteilt, aber dann kann man nur noch die Abstimmung beginnen, und das war´s. In weiterführenden direktdemokratischen Überlegungen ist es so, dass von der Bevölkerung Vorschläge kommen können, auch Änderungsvorschläge. Das ist ein etwas weitergestecktes Ziel.
MF: Wir wollen den Prozess der Direkten Demokratie in der Weise fördern, dass wir eine Software, ein Abstimmungstool, zur Verfügung stellen, das direktdemokratische Prozesse abbildet und das dann ab dem nächsten Jahr in Bremen zum Einsatz kommen kann.
JH: Das wäre also eine Form von Dialog über das Digitale Tool. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
ES: Ich denke, wir üben es in gewisser Weise bereits in den sozialen Medien, wo ja permanent ein Dialog stattfindet, gerade unter der jungen Bevölkerung. Aber wir sind noch nicht geübt, es auch im politischen Prozess anzuwenden.
MW: Ein Beispiel, das hier in Bremen momentan aktuell ist, sind die 136 Platanen am Neustädter Deich. Die stehen relativ nahe am Weserufer, und der Bremer Senat hat vor, die alle zu fällen, weil das angeblich notwendig ist, um den Hochwasserschutz zu gewährleisten. Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die das verhindern will. Die hat ein Gutachten anfertigen lassen, das zeigt, dass Hochwasserschutz auch ohne Fällung der Platanen möglich ist. Und es gibt das Bestreben, ein Volksbegehren durchzuführen zu diesem Thema, was mit hohem Aufwand verbunden ist.* Man muss sehr viele Unterschriften sammeln, und selbst, wenn das gelingt, wird es noch bis Mai 2023 dauern, bis im Zuge der Bürgerschaftswahl auch über das Volksbegehren abgestimmt wird. Gäbe es jetzt schon unser Abstimmungstool, hätte man schon viel früher die gesamte Bevölkerung Bremens fragen können: „Welche Lösung erscheint euch hier plausibler, die vom Senat oder die von der Bürgerinitiative?“ Und dann hätte man direktdemokratisch darüber entscheiden können.

JH: Wenn ich an Landespolitik denke oder auch Stadtpolitik, was ja hier in Bremen zusammenfällt, dann fällt mir die katastrophale Verödung der Innenstadt ein. Und dann diese Idee, eine Hüpfburg in der Martinistraße aufzustellen. Was könnte da Direkte Demokratie leisten?
MW: Direkte Demokratie bedeutet, die Bürger mehr einzubinden in die politischen Entscheidungen, denn sonst wird die Intelligenz, die unter den Menschen in Bremen verteilt ist, überhaupt nicht genutzt. Man lässt ein kleines „Experten“-Grüppchen Vorschläge ausarbeiten, die natürlich politisch korrekt formuliert werden. Man hat gar nicht versucht, auszubrechen aus dem Rahmen und wirklich kreative Lösungen zu entwickeln.
JH: Das heißt, diese Form von Direkter Demokratie, die euch vorschwebt, würde bedeuten: Wenn jetzt Abgeordenete von der Basis in der Bürgerschaft wären, würden die über eine digitale Form der Bürgerbeteiligung einfach Ideen abfragen?
ES: Das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Im ersten Schritt würden die Abgeordneten die Bremer Bevölkerung über die anstehenden Gesetzesvorhaben informieren und Abfragen machen, wie die Bürger dazu stehen. Dieses Votum würde dann ins Parlament gebracht werden. Dass die Bürger selber Dinge einbringen können, ist dann schon die Kür und nicht mehr die Pflicht, weil das sehr viel voraussetzt: Was kann man überhaupt in den Gesetzesprozess einbringen und was nicht? Was ist Landesebene? Was ist Bundesebene? Da muss man ja schon sehr viel Vorleistung bringen, bis das überhaupt vernünftig funktioniert.
Direkte Demokratie ist ein sehr großer Komplex, der in vielen Bereichen noch gar nicht durchdacht ist. Es hat solche Versuche ja schon gegeben, wie beispielsweise bei den Piraten mit „LiquidFeedback“, einer Software zur freien Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Da hat sich herausgestellt, dass es eine Zeitelite gibt: Menschen die viel Zeit im Netz verbringen können. Andere kommen da gar nicht mehr mit. Es sind also viele Dinge zu bedenken, deshalb haben wir uns für die Bürgerschaftswahl erst einmal nur die Pflicht vorgenommen: Was als Gesetzgebung geplant ist in Bremen, das bringen wir den Bürgern nahe und bieten die Möglichkeit zu sagen: „Das möchte ich“ oder „Das möchte ich nicht“.
JH: Neue Ideen entstehen ja auch aus der Unzufriedenheit mit dem Bisherigen. Wo gibt es Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie? Was macht die Direkte Demokratie anders oder besser?
MW: Ich glaube das ist gar kein Entweder-oder, sondern es gibt repräsentative Elemente, und es gibt direkte Elemente, auch heute schon. Die Frage ist eher, wie man den Schwerpunkt setzt oder ob man ein Stück weit repräsentative Elemente zu der direkten Schiene überführt. Was wir vorhaben, also dass die Abgeordneten in der Bürgerschaft nicht mehr nach eigenem Gusto oder nach Fraktionszwang abstimmen, sondern danach, was die Mehrheit der Bürger will, das ist ja nur ein kleiner Puzzlestein in der demokratischen Welt. Ich denke, die repräsentative Demokratie hat ihre Berechtigung in gewissem Maße gehabt, weil die Direkte Demokratie extrem aufwendig ist. Das ist nicht so einfach umsetzbar und schon gar nicht ohne digitale Mittel. Und die digitalen Mittel – dass fast jeder Bürger ein Smartphone besitzt –, das haben wir ja noch nicht lange. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten. Und deswegen geht es gar nicht so sehr gegen die repräsentative Demokratie an sich, sondern eher gegen die Auswüchse, die wir gerade bei uns erleben.
JH: Auswüchse?
MW: Na ja, dass unsere repräsentative Demokratie, wenn man so will, gekapert wurde von den Parteien. Also die Parteien repräsentieren ja die Macht heutzutage, und wenn ich etwas politisch bewegen will, geht das gar nicht anders, als dass ich schon in jungen Jahren in eine Partei eintrete und die sogenannte Ochsentour mitmache. Und weil es nicht jedermanns Sache ist, so etwas zu tun, deshalb haben wir nur eine ganz bestimmte Art von Menschen in der Politik aktiv. Und das ist überhaupt nicht mehr repräsentativ.
ES: Und es knirscht auch noch woanders: wenn Wahlen waren, und zu den Wahlen wurde den Bürgern etwas Bestimmtes versprochen, nach den Wahlen wurde es aber anders gemacht. Ich denke da zum Beispiel an die letzte Mehrwertsteuerhöhung, wo ja gesagt wurde: 14 bis 16 Prozent. Und zum Schluss waren es dann 19 Prozent. Die Bürger haben gar keine Eingriffsmöglichkeiten. Wenn das, wofür sie gestimmt haben, im Nachhinein nicht umgesetzt wird, müssen sie vier oder fünf Jahre warten, je nachdem, wie lang die Legislaturperiode ist, und können dann erst theoretisch wieder eingreifen. Bis dahin sind schon wieder so viele andere Dinge passiert, dass das, was davor war, schon Schnee von gestern ist.
Es wird zwar immer von der Bürgerbeteiligung gesprochen, aber die Bürgerbeteiligung, die die Politik uns Bürgern anbietet, ist nur eine Beteiligung an Informationsprozessen. Ich bekomme Informationen darüber, dass beispielsweise Platanen abgeholzt werden sollen. Und im besten Fall werde ich auch gefragt, was ich davon halte. Aber es ist keine Mitbestimmung, denn die Entscheidung darüber bleibt ganz allein bei der Politik, also bei den Verantwortlichen, die durch die repräsentative Demokratie in die entsprechenden Ämter gewählt wurden.
JH: Die Jusos hatten irgendwann einmal die Idee des imperativen Mandats: ein Mandat, bei dem die Abgeordneten an die Aufträge ihrer Wähler gebunden sind. Ich meine, das ist als nicht verfassungskonform zurückgewiesen worden, weil die Abgeordneten – zumindest theoretisch – nur ihrem Gewissen verpflichtet sein sollen. Wie geht ihr damit um?
ES: Ich gehe davon aus, dass diese Frage, wenn wir tatsächlich Erfolg haben, sowohl politisch, als auch juristisch, behandelt werden wird.
MF: Im Grundgesetz heißt es ja, dass die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Aber de facto sehen wir, dass die Parteien den politischen Willen bestimmen. Mir geht es darum, die Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen und den Bürger abzuholen. Wenn man herumfragt, hat man immer den Eindruck, dass es eine Abgehobenheit der Politik gibt, dass die Verbindung komplett verloren gegangen ist. Und darum geht es natürlich auch. Im Idealfall ist da gar nicht so ein Widerspruch zwischen Repräsentativer Demokratie und Direkter Demokratie. Die Frage ist, wen der Repräsentant repräsentiert. Wenn er den Souverän repräsentiert, gibit es da wahrscheinlich kein Problem.

JH: Erich, du hattest gesagt, dass die Direkte Demokratie noch diskussionsbedürftig ist. Ich hatte mir als Beispiel die Hamburger Initiative „Wir wollen lernen“ angeschaut. Da haben die wohlhabenden und einflussreichen Schichten eine Schuklreform per Volksentscheid verhindert. Und es gibt ja einfach Menschen, die sind computer- oder internetaffiner, die haben mehr Informationen und, und, und. Also, läuft das nicht auch bei Direkter Demokratie wieder auf eine Bevorzugung bestimmter Schichten hinaus?
ES: Die Gefahr besteht auf alle Fälle. Das Hamburger Beispiel zeigt das recht gut: Es wurde viel Geld in die Hand genommen von dieser kleinen Gruppe von Menschen. Sie hatten die Möglichkeit, entsprechend Werbung zu machen, Flugblätter zu drucken und dergleichen mehr, um dann tatsächlich die Entscheidung in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Wenn wir als Partei im Parlament sind, haben wir die Möglichkeit, die Bürger gleichmäßig zu informieren, sowohl über die Vor- als auch die Nachteile eines Gesetzes. Dazu müssen noch Prozesse entwickelt werden, damit das gewährleistet ist. Wir haben heute keine ausgewogene Berichterstattung in den Medien mehr. Der Diskussionsraum ist eingeengt auf einen ganz kleinen Bereich, innerhalb dessen gestritten werden darf. Alles, was außerhalb dieses Bereiches ist, fällt heraus. Wir müssen den Raum, in dem eine Diskussion stattfinden kann, wieder weiten.
JH: Der Sender Radio Bremen betreibt auf seiner Webseite einen „Meinungsmelder“. Da sprachen sich vor kurzem* 61 Prozent der Befragten für eine Maskenpflicht aus. Gleichzeitig steht im Gutachten des Sachverständigenrates zu den Coronamaßnahmen der Bundesregierung: „Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar.“ Das taucht natürlich in den Medien nicht auf – es wird immer das Gegenteil propagiert. Ist Direkte Demokratie überhaupt bei dieser Gleichschaltung der Medien möglich?
MF: Ja, aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich der Frage: Was ist das Demokratieverständnis? Die Abstimmung an sich ist doch nicht Demokratie –das ist ein falsches Verständnis. Der Kernpunkt der Demokratie ist der Dialog, der Austausch und Widerstreit der unterschiedlichen Personen im öffentlichen Raum. Und da haben wir genau die Situation, dass die Leute einfach nicht die vollständigen Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Darum lautet der Auftrag an die Abgeordneten der „Basis“, das gesamte Spektrum der Positionen zu öffnen und die Diskussion wieder breiter zu machen, gegen diese Verengung des Meinungskorridors zu arbeiten.
Wir haben jetzt einen Nichtwähleranteil, der teilweise an der 50-Prozent-Marke knabbert. Bei Kommunalwahlen ist es wahrscheinlich noch katastrophaler, weil die Leute merken: Es ist egal, wie ich abstimme! Wenn wir mit unserem Konzept der Direkten Demokratie den Menschen das Gefühl vermitteln: „Meine Stimme hat Gewicht“, dann könnte das wieder zu einer Politisierung und auch zu einer Wertschätzung der Bürgerinteressen führen. Und das sehe ich als den ganz großen Wert des wieder geöffneten Debattenraums und der stärkeren Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den demokratischen Abstimmungsprozess.
JH: Nun hat es dieBasis im öffentlichen Raum aber nicht leicht. Wenn ich im Bekanntenkreis erzähle, dass ich heute ein Interview mit Basis-Mitgliedern mache, werde ich unter Umständen gefragt: „Wieso triffst du dich denn mit Rechten?“ Wie ist es dazu gekommen?
ES: Das ist aus dem Framing entstanden, das schon früh eingesetzt hat. Alles, was nicht in diesem Diskursraum Platz hatte, wurde abgewertet und als „rechts“ geframed. Innerhalb des Diskursraumes darf man sehr kontrovers diskutieren, aber was außerhalb ist, das ist „bäh“ oder eben „rechts“. Und wenn jemand als „rechts“ abgetan ist, muss man mit dem auch nicht mehr sprechen. Dieses Framing hat schon zu Beginn der Coronamaßnahmen eingesetzt: Alle Gruppen, die sich gegen die Coronamaßnahmen ausgesprochen haben, ob es nun Ärzte waren oder Juristen oder Parteien (dieBasis hat ja Vorläufer wie Widerstand 2020 und WIR 2020), wurden sofort in die rechte Ecke gestellt.
Auf manchen Demonstrationen gab es auch tatsächlich Leute aus der rechten Szene, und da konnte man sagen: „Kontaktschuld! Ihr marschiert da mit den Rechten!“ Für die Antifa hat sich da ein herrliches Feld aufgetan. Sie haben jetzt einen Feind, der noch nicht einmal sonderlich gefährlich ist und bei dem sie zeigen können, wie sie die Demokratie gegen die „bösen Rechten“ verteidigen.
Und es betrifft ja nicht nur uns. Man nehme mal Frau Wagenknecht, die Mitglied der Linkspartei ist. Der wird „Querfront“ vorgeworfen, die Bedienung von rechten Ressentiments und dergleichen mehr. Das ist ein Elend unserer Zeit, das kann man nicht anders sagen. Ich finde es bedauerlich, dass der Diskussionsraum so eingeschränkt ist, aber da werden wir vorerst nichts gegen machen können. Wir können nur sagen: „Wir wollen ihn erweitern!“ Wenn wir gewählt werden, bieten wir die Möglichkeiten dazu. Wir werden den Raum wieder öffnen, und dann können die Menschen selbst entscheiden, was sie lesen wollen oder nicht, und sie müssen nicht darauf hören, ob ihnen jemand sagt: Das ist richtig oder das ist falsch.

JH: Ich hatte letztens Gäste aus Frankreich, und als ich denen erzählt habe, dass man bei uns in den 70er-Jahren als Kommunist noch nicht einmal Lokführer werden konnte, da haben sie schallend gelacht und es mir nicht geglaubt. Das scheint etwas ganz typisch Deutsches zu sein, andere verächtlich zu machen und bis zur Vernichtung auszugrenzen. Rechnet ihr trotzdem damit, das euer Ansatz vielleicht irgendwann einmal im Regionalprogramm von Radio Bremen vorgestellt wird?
ES: Ja, auf jeden Fall! Die Medien mögen ihre Agenda haben und in eine bestimmte Richtung agieren. Aber in dem Augenblick, wo eine neue Partei über einen bestimmten Prozentsatz kommt, können sie gar nicht anders, als sich damit zu beschäftigen. Es kann natürlich sein, dass diese Beschäftigung nicht unbedingt positiv ist und vielleicht auch in den Bereich der Verächtlichmachung fällt. Aber Ignoranz ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich. In dem Sinne glaube ich, dass, wenn wir erfolgreich sind und in den Umfragen bei drei bis vier Prozent liegen, sie gar nicht umhin können, sich mit uns zu beschäftigen. Sie müssen ja auch bedienen, dass es etwas Neues gibt. Und eine neue Partei, die mit der Direkten Demokratie ankommt, das hat es bisher noch nicht gegeben. Wir müssen also nur über diesen Punkt hinaus, wo man uns ignorieren kann.
Und es gibt noch einen anderen Aspekt: Als ich noch bei den Piraten war, hatten wir den Begriff der Transparenz in die Öffentlichkeit gebracht, und es hat nur wenige Monate gedauert, und plötzlich haben alle Parteien nur noch von Transparenz gesprochen. Das geht schneller als man denken kann, dass Begrifflichkeiten adaptiert und umgewandelt werden. Deshalb verwenden wir auch nicht den schwammigen Begriff „Basisdemokratie“, weil man da ganz schnell sagen kann: „Ach, Basisdemokratie, das machen wir als Grüne schon seit dreißig Jahren.“ Der Begriff der Direkten Demokratie dagegen ist politisch klar definiert und kann schwer umgewandelt werden. Das verhindert, dass die anderen Parteien ihn aufgreifen und in ihrem Sinne benutzen können. – Und ich glaube, dass die anderen Parteien Angst davor bekommen werden.
JH: Vielen Dank für dieses Gespräch.
Fotos: Georg Maria Vormschlag
*) Das Gespräch wurde im Oktober 2022 geführt. Die Bürgerinitiative zur Rettung der Platanen hat die nötigen Unterschriften für das Volksbegehren zusammenbekommen, der Senat hat das Begehren aber für unzulässig erklärt.
